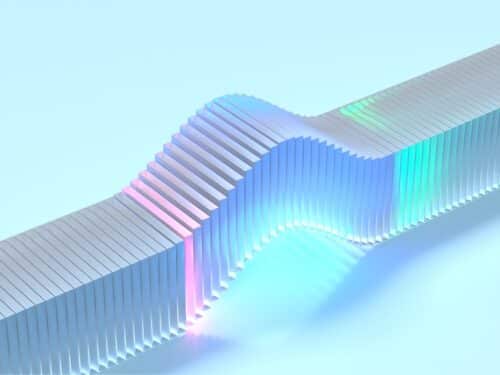Selbst große Konzerne werben heute mit einer familiären Unternehmenskultur. Dahinter steckt das Idealbild eines fürsorglichen Arbeitgebers auf der einen Seite und eines loyal an das Unternehmen gebundenen Mitarbeiters auf der anderen. Allerdings: Auch Beziehungen in Familien sind selten nur harmonisch und konstruktiv.
Wer einen Job beim Vakuumtechnik-Hersteller J. Schmalz im beschaulichen Schwarzwald-Örtchen Glatten antritt, der führt fortan ein sorgenfreies Leben. Die Kinder kommen in der Betriebskita unter, die alternden Eltern in der örtlichen Seniorenanlage, an deren Bau sich die Firma beteiligt. Für das körperliche Wohl sorgen ein eigens angelegtes Naherholungsgebiet auf dem Firmengelände, Sport- und Gesundheitskurse und Massagen beim Firmen-Physiotherapeuten. Ein Lebenslagenberater hilft bei privaten oder beruflichen Problemen. Und die betriebseigene Weiterbildungsakademie unterstützt nicht nur bei der beruflichen Weiterbildung: Schmalz-Mitarbeiter bieten in ihrer Freizeit auch Hobby- und Freizeitkurse wie etwa Koch- und Yoga-Workshops an. „Lifeplus“ nennt das Unternehmen sein Leistungspaket für „alle Lebensfelder der Mitarbeitenden“. Mitarbeiter müssen eigentlich nur zum Schlafen das Firmengelände verlassen.
Teil einer Gemeinschaft
Das Angebot des Mittelständlers aus dem Schwarzwald erinnert an die Rundum-sorglos-Pakete, die auch internationale Großkonzerne wie Google, Apple oder Facebook für ihre Mitarbeiter schnüren. Das damit verbundene Versprechen geht über ein paar Zusatzleistungen zum Gehalt und eine freundliche, bunt gestaltete Arbeitsumgebung weit hinaus. Es lautet: Du bist hier Teil einer Gemeinschaft, wir kümmern uns um dich. Die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit, beruflichen und privaten Beziehungen verschwimmen. Das Management kreiert eine Wohlfühlatmosphäre rund um den Arbeitsplatz, die dafür sorgen soll, dass sich Mitarbeiter eng an das Unternehmen binden, sich emotional engagieren und sich mit dem Arbeitgeber identifizieren.
Dieses Versprechen von persönlicher Eingebundenheit in eine enge Gemeinschaft scheint in Zeiten, in denen soziale Strukturen und Bindungen außerhalb der Arbeitswelt vielfach erodieren, viele Menschen anzusprechen – im Silicon Valley ebenso wie im Schwarzwald.
Patriarchale Verhältnisse
Doch Kritiker warnen vor den Risiken einer allzu persönlich und familiär gestalteten Unternehmenskultur. „Unternehmer und Mitarbeiter sollten sich kritisch die Frage stellen, welche Folgen sie sich mit dieser auf den ersten Blick für beide Seiten sehr angenehmen Arbeitswelt einhandeln“, mahnt etwa Arbeitssoziologe Klaus Kock von der Technischen Universität Dortmund. „Denn was da so als moderne, menschliche und für die digitalisierte Arbeitswelt passende Art der Zusammenarbeit daherkommt, rutscht schnell in ein übergriffiges, im Kern patriarchales und vormodernes Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ab.“
Das Bild des Unternehmers, der sich fürsorglich um seine Mitarbeiter kümmert und enge, persönliche, ja fast familiäre Bindungen zu ihnen pflegt, sei ja schließlich kein ganz neuartiges. „Wir kennen das aus traditionellen Familienunternehmen, zu deren Selbstbild eben dieses Kümmern um die Mitarbeiter und diese informellen, persönlichen Beziehungen im Unternehmen gehören“, sagt Kock. „Und aus den Erfahrungen mit diesen Unternehmen wissen wir: Das kann sehr gut funktionieren. Es kann aber auch richtig schiefgehen.“ Denn wo Mitarbeiter und Führungskräfte enge, persönliche Beziehungen zueinander pflegen, werde eben auch jeder Konflikt schnellpersönlich. Private Netzwerke, Cliquen und Sympathien gewinnen an Einfluss. Und die schönen Zusatzleistungen basieren letztlich auf dem Wohlwollen des Firmeninhabers – um dessen Gunst die Mitarbeiter also buhlen müssen. Das kann zu lähmender Unsicherheit und Unfrieden in der Belegschaft führen. „Auf Unternehmen, die all diese Faktoren so steuern wollen, dass auch tatsächlich ein im positiven Sinne familiäres Betriebsklima entsteht und die Leute motiviert und loyal bleiben, kommt richtig viel Arbeit zu“, betont Kock. „Mit dem Einstellen eines Feelgood-Managers und dem Aufstellen eines Kickertisches ist es da nicht getan.“
Feierabend ist Feierabend
Traditionelle Familienunternehmen wie Schmalz verwehren sich ohnehin gegen den Vergleich mit den Feelgood-Programmen von Google und Co. „Es stimmt zwar, dass wir mit unserem Paket aus Zusatzleistungen und Freizeitangeboten anstreben, mit konkurrierenden Konzernen mithalten zu können“, räumt Schmalz-Personalchef Daniel Just ein. „Schließlich stehen wir mit größeren Unternehmen, die bekanntere Namen und oft Standorte in beliebten städtischen Regionen haben, im Wettbewerb um Fachkräfte.“
Um potenzielle Bewerber auf den Hidden Champion im Schwarzwald aufmerksam zu machen und sie davon zu überzeugen, dass ein Umzug nach Glatten lohnt, müsse sich das Unternehmen eben etwas einfallen lassen. „Aber unsere Intention und Herangehensweise ist eine andere als die von Unternehmen wie Google oder Facebook“, betont Just. Diese würden mit ihren Dienstleistungsangeboten vom Gratis-Obstkorb bis hin zum Friseur- und Wäscheservice auf dem Firmengelände vor allem dafür sorgen, dass die Mitarbeiter möglichst rund um die Uhr arbeiten können. „Darum geht es uns nicht“, sagt der Personalleiter. „Es ist aus unserer Sicht sogar sehr wichtig, dass die Mitarbeiter ein echtes Privatleben haben. Feierabend ist Feierabend, den soll jeder so verbringen, wie er will.“
Ziel der Freizeitangebote für Mitarbeiter sei ein anderes: „Wir wollen die Vorteile der familiären Kultur, die wir als Familienunternehmen in dritter Generation mitbringen, auch bei starkem internationalem Wachstum und inzwischen rund 800 Mitarbeitern hier am Standort in Glatten weiter bewahren und nutzen.“ Mitarbeiter sollen sich bei den gemeinsamen Freizeitaktivitäten etwa gegenseitig persönlich kennenlernen und vernetzen, auch über Abteilungsgrenzen und Funktionen hinweg. Das erleichtere die flexible Zusammenarbeit bei Projekten und Aufträgen. „Uns ist es auch wichtig, dass sich die Mitarbeiter weiter persönlich in ihren Bedürfnissen und Interessen ernst genommen fühlen“, sagt Personalleiter Just. „Natürlich können die geschäftsführenden Gesellschafter heute nicht mehr jeden Mitarbeiter mit Namen kennen oder bei jedem Geburtstag einen Blumenstrauß überreichen“, erklärt er. „Aber wir würden deshalb niemals einen Feelgood-Manager einstellen, der solche Aufgaben übernimmt, wie das manche Großkonzerne machen. Das würde nicht zu uns passen.“ Die Geschäftsführer geben sich stattdessen weiterhin nahbar, indem sie etwa im Betriebsrestaurant essen und bei wichtigen Veranstaltungen Präsenz zeigen. „Und für die Zufriedenheit der Mitarbeiter und dafür, dass in den Teams die Motivation stimmt, sind die Führungskräfte auf allen Ebenen zuständig, die sind dazu angehalten, sehr persönlich zu führen und immer den Mensch hinter den Zahlen zu sehen“, sagt Just.
Mitarbeiter: Ressource oder Person?
Familienunternehmen, so scheint es, verstehen unter familiärer Mitarbeiterführung und Unternehmenskultur also etwas anderes als Tech-Konzerne und Start-ups. „Die künstlichen persönlichen Beziehungsstrukturen, die Konzerne wie Google in ihren Belegschaften fördern, sprechen die Mitarbeiter letztlich doch sehr stark als Ressource an, nicht als Person“, analysiert Marcel Hülsbeck, Professor für Personal und Organisation am Wittener Institut für Familienunternehmen. „Das ist, wenn man mal ehrlich ist, ja eher Käfighaltung von Programmierern als echte familiäre Unternehmenskultur.“ Was Mitarbeiter in Familienunternehmen hingegen schätzen, sei eine handfestere Verbindlichkeit: „In Familienunternehmen heißt es im Idealfall: Du musst deine Hemden zwar weiter selbst bügeln, aber dafür wirst du hier auch in zehn Jahren noch einen Arbeitsplatz haben.“
Dieses Fürsorge-Versprechen sei für viele Mitarbeiter attraktiv und letztlich glaubwürdiger als Verwöhnprogramme à la Google. „Familiär darf nicht heißen: Alles wird informell, private und berufliche Rollen lösen sich auf und verschmelzen“, betont Hülsbeck. „Die Personalforschung zeigt, dass Mitarbeiter vor allem Rollensicherheit haben wollen und klare, objektivierbare Leistungsvereinbarungen.“
Das klingt im Vergleich zu den Feelgood-Versprechen der quietschbunten, spaßorientierten Arbeitswelten der Tech-Konzerne und Start-ups recht bieder – könnte aber der nachhaltig erfolgreichere Ansatz sein, meint auch Caterine Schwierz von der Personalberatung Rundstedt. „Letztlich geht es ja darum, dass Unternehmen zufriedene Mitarbeiter haben wollen, die gerne im Unternehmen arbeiten“, konstatiert sie. „Dazu braucht es kein Betüddeln und keine Verwöhnprogramme. Sondern gute Führung, die Mitarbeiter ernst nimmt und sie dabei unterstützt, sich persönlich weiterzuentwickeln.“
Poolparty versus Coaching
Gefragt sei gutes, durchdachtes Personalmanagement, kein oberflächliches Feelgood-Management. „Da kann es etwa sinnvoller sein, jungen Mitarbeitern ein individuelles Karriere-Coaching anzubieten, das ihnen echte Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigt, als sie mit einem Team-Urlaub oder mit Poolpartys zu locken.“ Oder Mitarbeitern in der Familienphase flexible Arbeitszeiten zu ermöglichen, statt viel Geld in eine Betriebskita zu investieren.
Unternehmen, die sich keine Rundum-sorglos-Pakete für ihre Mitarbeiter leisten können oder wollen, müssen sich also wohl auch zukünftig keine Sorgen machen, dass ihnen die Angestellten in Scharen davonlaufen. Selbst in der IT-Branche, in der der Wettbewerb um Fachkräfte auch hierzulande bereits besonders hart geführt wird, könnte der Trend zur pseudo-familiären Kultur und zur Entgrenzung von Arbeit und Freizeit mittelfristig im Sande verlaufen. „Es ist natürlich zunächst einmal spannend und motivierend, am Arbeitsplatz Teil einer großen Familie zu sein und mit all den anderen Familienmitgliedern Auszeiten am Kickertisch oder bei gemeinsamen Events zu verbringen“, sagt Heidi Mrugalla, HR-Managerin beim Fintech-Unternehmen Gastrofix in Hamburg. „Wir beobachten aber, dass der Effekt relativ schnell verpufft und die Mitarbeiter die Angebote nach kurzer Zeit als selbstverständlich erachten. Spätestens wenn Mitarbeiter dann nach einer gewissen Zeit merken, welchen negativen Einfluss ständige Überstunden und fehlendes echtes Privatleben auf das soziale Umfeld und die eigene Gesundheit haben können, überdenken viele ihre Einstellung.“ Das heiße nicht, dass Unternehmen auf ein angenehmes, attraktives Arbeitsumfeld und regelmäßige Teamevents generell verzichten sollten, stellt Mrugalla klar. „Bei uns gibt es zum Beispiel ein Friday-Meet-up mit Pizza und Bier; auch gemeinsam gefrühstückt wird regelmäßig.“
Das Ziel dürfe aber nicht sein, den Mitarbeitern eine Mentalität aufzuzwingen, mit der sie sich 24 Stunden täglich an sieben Tagen pro Woche ihrem Arbeitgeber und den Kollegen verpflichtet fühlen, sagt die Personalleiterin. „Wir haben jedenfalls die Erfahrung gemacht, dass eine klare Trennung von Arbeits- und Privatleben deutlich produktiver ist als eine Always-on-Mentalität.“