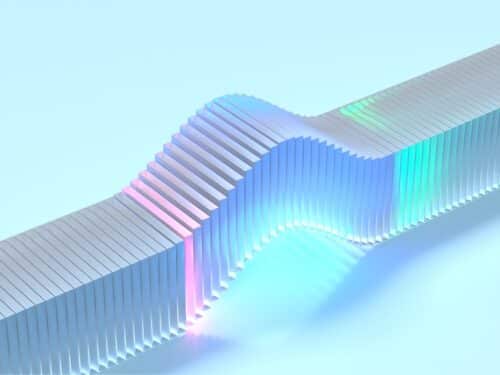Hierarchie schreibt Führungskräften einen gewissen Status zu. Selbstorganisierte Teams kommen hingegen ohne eine Machthaberin oder einen Dirigenten aus. Wie lassen sich starre Strukturen auflösen?
Gut fünf Jahre lang hat das Fintech-Unternehmen Smartsteuer immer wieder optimiert, agile Arbeitsweisen ausprobiert und mit Scrum gearbeitet. Abteilungen spürten graduelle Verbesserungen mal mehr, meist aber weniger. Es fehlte nicht nur der Blick aufs Ganze, sondern auch, aufs Ganze zu gehen. Bequemlichkeit hatte sich eingeschlichen. Es reichte der Anspruch, hier und da eine Verbesserung zu erreichen. Doch dies ging zulasten der Innovationskraft. Ein stetig steigender Wettbewerbsdruck hat das verdeutlicht.
Ein Gedanke des Managements setzte den Wandlungsprozess in Gang: Es bräuchte ein neues Führungskonzept, um den Beobachtungen, Einflüssen und Veränderungen gerecht zu werden. Schließlich gibt das Management die Richtung vor, in die ein Unternehmen und die Mitarbeitenden gehen möchte. Es gleicht einem Orchester: Einige wenige geben den Ton an, jedes Teammitglied beherrscht ein Instrument, alle harmonieren im Zusammenspiel. Das Repertoire ist bestens einstudiert und wechselt nur selten. Im Laufe der Zeit stellten alle Beteiligten in Team- und Management-Meetings sowie internen Workshops fest: Wir wollen nicht das schon Dagewesene immer wieder zur Aufführung bringen, sondern das noch nie Gehörte. Dabei sollte es möglichst frei zugehen, ohne Notenvorgabe von Dirigierenden, lieber wie in einer Jazzband.
Selbstorganisiert, aber mit Struktur
Im Herbst 2019 haben wir uns als Unternehmen neu organisiert: Das Management löste sich quasi auf, bis auf den Geschäftsführer, den es formell auf dem Papier geben muss. Auf die Ebene der Teamleitung inklusive der Gespräche mit unseren Beschäftigten verzichten wir seither. Stattdessen sind alle zu Führungskräften geworden. Weiterbildungsbudgets stehen allen zur Verfügung. Über Urlaube entscheidet jede und jeder selbst.
Keine Hierarchie, keine Regeln? Falsch. Regeln sind wichtiger denn je, auch wenn sie struktureller Natur sind. Das haben wir dank der New-Work-Beraterinnen von Freischwimmer gelernt, die in den Prozess eingebunden war und uns beim Umbruch angeleitet hat. Unterstützt haben uns Crashkurse in Systemtheorie und Kulturmusteranalyse. Durch diese theoretischen Grundlagen konnten wir besser erkennen, welchen strukturellen Rahmen wir für unsere neue Arbeit brauchen. In Einzelbefragungen und in gemeinsamen Workshops haben wir erarbeitet, was unsere Unternehmenskultur ausmacht und wie sie sich äußert – und dabei verstanden, dass sie maßgeblich von den zugrunde liegenden Strukturen abhängt. Die Appelle zu innovativer Arbeit verhallen, wenn sich an den Strukturen nichts ändert. Neues Arbeiten braucht neue Strukturen.
Für uns war klar: Wir wollen mit dem kleinstmöglichen Struktur-Set-up starten. Das bedeutet: nur das Minimum vorzugeben und der Rest soll sich von alleine ergeben. Nach monatelangem Analysieren und Diskutieren verständigten wir uns auf drei Kernelemente: den Strategiekreis, die Verantwortungsdreiecke und den Thesenbasar.
- Der Strategiekreis besteht aus festen sowie stetig wechselnden Mitgliedern. Gemeinsam legen sie die Leitlinien für das Unternehmen fest, innerhalb derer sich alle bewegen. Ein Beispiel ist dabei etwa die Einigung auf Kosten pro Neukunde, die Smartsteuer bereit ist zu zahlen. Auch erarbeiten sie die Vision und die daraus abgeleitete Strategie und stellen diese im Anschluss dem gesamten Team vor.
- Bei all dem Drang, innovationsgetriebener zu arbeiten, bleibt ein Großteil der Arbeit dem Tagesgeschäft vorbehalten. Um genau zu wissen, was dabei zu tun ist, hilft eine Aufgabeninventur. Diese liefert eine Liste mit notwendigen Aufgaben und Verantwortlichkeiten, die wir – zum Teil geclustert – in sogenannten Verantwortungsdreiecken neu aufgeteilt haben. Drei Mitglieder teilen sich die Verantwortung für ein bestimmtes Thema und können im gemeinsamen Austausch weiter daran arbeiten. Der Vorteil: Einzelne Mitglieder können sich bei Bedarf aus dem Verantwortungsdreieck zurückziehen. Bedarf meint dabei nicht nur einen möglichen personellen Ausfall, sondern vor allem das Engagement in Innovationsprojekten.
- Diese besondere Projekte werden Missionen genannt und von Missions-Teams bearbeitet. Hier entstehen die Innovations-Jazz-Stücke, die wir dann zur Aufführung bringen. Jede Mission braucht unterschiedliche Ressourcen und damit unterschiedlich viele Mitglieder. Ob aus einer Idee eine Mission wird, entscheidet sich auf dem monatlichen Thesenbasar.
Gewissermaßen ist der Thesenbasar die Keimzelle für Innovationen und der Raum, den wir als Unternehmen gerne schaffen wollten. Unsere Fragestellung dahinter: Woher kommen die Impulse, um innovative Ideen zu provozieren? Nicht aus dem hierarchischen, titelbasierten System. Vielmehr entstehen Ideen dort, wo der direkte Kontakt mit Auftraggeberinnen und Kunden besteht – nämlich auf der Arbeitsebene.
Demokratie schadet Innovationen
Die daran anschließende Frage lautet: Wie stellen wir sicher, dass sich eine Idee durchsetzt? In der klassischen Arbeitswelt sorgen meist Seniorität oder Lautstärke dafür. Moderne und vor allem agile Methoden dagegen setzen auf den demokratischen Mehrheitsentscheid. Dieser kann aber auch gefährlich sein: Die richtig guten, großen Ideen sind oftmals nicht mehrheitsfähig. Sie hinterfragen Bewährtes, erfordern unerprobte Lösungsansätze. Das führt oft zu Zurückhaltung oder gar Ablehnung. Eine demokratische Abstimmung führt dann nur zu Durchschnittslösungen, nicht zu echter Innovation.
Wir haben uns daher für eine sprichwörtliche Abstimmung mit den Füßen entschieden. Das heißt, nach mehreren Feedbackrunden im Rahmen des Thesenbasars schauen wir, wie viele Mitglieder an der vorgestellten Idee arbeiten möchten und ob in Summe alle erforderlichen Profile zusammenkommen. Ist das der Fall, dann nimmt das neu formierte, cross-funktionale Missions-Team seine Arbeit auf. Alle Beteiligten bekommen so die Chance, gute Ideen in die Tat umzusetzen. Die Ideen müssen sich letztlich am Markt beweisen. Eine erste Idee nach der Reorganisation: ein grundlegendes Update der Software-Architektur unseres Produktes – eine Sache, die ich als Geschäftsführer vorher immer blockiert habe, weil sie aufwendig erscheint und für die Kundschaft keinen direkten Mehrwert erzeugt.
Situative Führungswechsel
Seit der Reorganisation bewegen wir uns durch Versuch und Irrtum kontinuierlich nach vorn. Das ist für alle Beteiligten ein großer Kraftakt, vor allem mit Blick auf den fließenden Wechsel vom Führen und Geführtwerden. Meine Überzeugung: Jeder von uns besitzt auch Führungspotenzial. Es braucht nur ein individuelles Wecken der Leidenschaft und eine neue Form der Orientierung – und vor allem die Sicherheit „Ich darf führen!“. Denn ohne klassische Führung mit Anweisungen und Direktiven kommt leicht Unsicherheit auf: „Wer darf was? Soll ich das? Will ich das überhaupt?“ Was sich in der Theorie vielleicht logisch anhört, hat sich bei uns bewahrheitet: Ein auf Selbstorganisation und Selbstwirksamkeit ausgelegtes Unternehmen basiert auf einer klaren Vision sowie definierten strategischen Zielen.
Bei dem Gedanken, zwischen Führen und Geführtwerden hin und her zu wechseln, sind nicht immer alle sofort Feuer und Flamme. Ebenso kommen häufig Fragen auf, wie mit Konflikten umzugehen ist oder wie sich der Wissenstransfer organisieren lässt – und wer hat eigentlich Küchendienst? Der Schlüssel liegt in der breiten Vermittlung von Führungskompetenzen sowie in der befähigenden Hilfe zur Selbsthilfe. Wir haben beispielsweise positive Erfahrungen mit speziellen Coachings zur internen Kommunikation und zum Konfliktmanagement gemacht. Ganz wichtig erscheinen zudem die regelmäßigen Retrospektiven, bei denen alles zur Sprache kommt, was vielleicht noch nicht läuft und was es noch zu klären gilt.
Dass ohne Hierarchie auch bedeutet, ohne Führung zu arbeiten, ist ein Missverständnis, das wir anfangs selbst hatten: Führung ist nicht weg, sie ist nur auf mehr Schultern verteilt und situativer. Die ehemaligen Leitungen der Teams sind auch heute noch fachlich und menschlich wichtige Bezugspersonen. Ihre Autorität basiert nun aber ausschließlich auf Zuschreibungen durch die Mitarbeitenden, nicht durch formal verliehene Macht. Man könnte also sagen, dass ihr Status sogar gestiegen ist, weil die Quelle dessen das Team selbst ist.
Was als Management-Initiative gestartet ist, hat alle Mitarbeitenden mit einbezogen. Sie waren Teil des Wandlungsprozesses, konnten mitgestalten und absehen, was auf sie zukommt. Ein Kollege meinte in einem der ersten Workshops: „Das wird anstrengend, aber ich freue mich darauf!“ Dieser Satz spiegelt bis heute die Stimmung im Team wider. Noch hat zumindest niemand die Wiedereinführung der Hierarchie als bahnbrechende Idee im Thesenbasar vorgestellt.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Status. Das Heft können Sie hier bestellen.