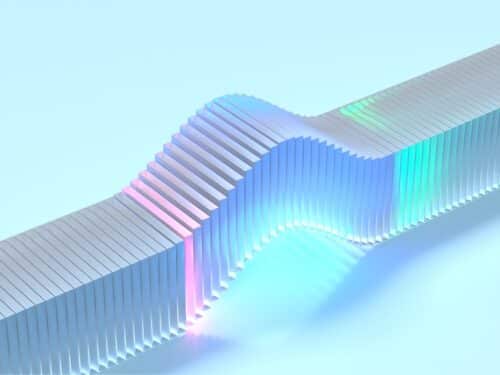Franziska Seyboldt ist Redakteurin bei der Berliner Tageszeitung Taz. Eines Tages wütet eine Panikattacke durch ihren Körper. Sie muss aus der Redaktionskonferenz fliehen. Die Kollegen merken nichts. Doch die heute 35-Jährige entscheidet, der Angst die Stirn zu bieten und sich öffentlich zu ihr zu bekennen. Die Geschichte eines mühsamen Wegs.
Ein wenig fröstelt Franziska Seyboldt an diesem grauen Oktobertag. Vor zwei Tagen spazierte sie noch in der griechischen Sonne. Nun zurück aus dem Urlaub, im verregneten Berlin, steht die Journalistin auf dem Wasserturmplatz im Prenzlauer Berg, ihre blonden Locken wehen im Wind. Sie lacht viel, wirkt gelöst, wir bieten uns das Du an. Vereinzelt stromern Hunde auf der Wiese herum, hier an dem Ort, an dem sie oft selbst mit ihrem Hund spazieren geht, um zur Ruhe zu kommen.
Früher beherrschte Angst ihren Alltag: Flugangst, Angst vor dem Autofahren, Angst, ohnmächtig zu werden, wenn die Augen auf sie gerichtet sind. Generalisierte Angststörung, lautete die Diagnose. Vor drei Jahren ließ sie in einem Artikel in der Wochenendausgabe und auf taz.de alle seelischen Hüllen fallen und bekannte sich öffentlich dazu. 2018 schrieb sie über ihre Genese von einer zweifelnden Mittzwanzigerin zu einer selbstbewussten Frau einen klugen Roman. „Rattatatam, mein Herz“ wurde in den Medien viel besprochen und ist ein sehr persönliches Plädoyer dafür, Angst nicht als Schwäche zu verteufeln, sondern auf das zu hören, was sie einem zu sagen hat. Für Franziska Seyboldt stand damals fest: Entweder sie beginnt eine Therapie oder sie muss ihren Job kündigen. Im Restaurant Masel Topf, kommentiert sie einige Romanpassagen über ihr Arbeitsleben mit der Angst.
Die dunkleren Seiten meiner Persönlichkeit, oder zumindest die, die ich dafür hielt, klammerte ich lange radikal aus. So richtig bewusst wurde mir das allerdings erst vor sieben Jahren.
Mein damaliger Chef hatte mich zu einem Feedbackgespräch bestellt, jetzt saßen wir bei Kaffee und Kuchen in der Kantine. Ich war nervös. Was, wenn ich mein erstes Jahr vermasselt hatte? Glücklicherweise stellte sich heraus, dass mein Chef meine Arbeit schätzte. Zwar gebe es noch ein paar kleinere inhaltliche Baustellen, das schon, aber im Großen und Ganzen laufe doch alles prima. […]
»Seit du hier arbeitest«‚ sagte er, »hat sich die Stimmung in der Redaktion wirklich positiv verändert.«
Was ich hörte, war:»Inhaltlich bist du eine Katastrophe, aber wenigstens ist es lustig mit dir.«
[…] Gefangen in den eigenen komplizierten Denkstrukturen, glich ich das Gehörte mit meinen Erfahrungen ab und bewertete es so, wie ich es gewohnt war. Anstatt mich auf das Lob zu konzentrieren, hörte ich nur Kritik, anstatt jeden Punkt einzeln zu betrachten, wog ich sie gegeneinander auf.
Franziska Seyboldt,
„Rattatatam, mein Herz. Vom Leben mit der Angst”,256 Seiten, Kiepenheuer & Witsch, 2018, 16,99 Euro
Franziska, wie ging es dir zu diesem Zeitpunkt, was das Ausmaß der Angst betraf?
Ich war 24 und befand mich in einer Hochphase meiner Angst. Ich bin damals von Hamburg nach Berlin gezogen und habe meinen ersten Job als Redakteurin angefangen. Die riesige Stadt mit ihrem Trubel, den schlechten Gerüchen überall, eingepfercht zu sein in der U-Bahn mitten im Berufsverkehr: Auf einmal bekam ich Panikattacken im überfüllten Waggon auf meinem Weg zur Arbeit. Außerdem war ich die, die nur was mit Mode studiert hatte, wurde ohne Volontariat Redakteurin. Mein Chef konnte mich mit seiner Einschätzungso verunsichern, weil ich sowieso schon die ganze Zeit Angst hatte, nicht tough genug zu sein, nicht genug politisches Wissen zu haben. Der innere Druck war hoch und bot den perfekten Nährboden für die Angst, die auch vorher schon in mir geschlummert hatte.
Nachdem ich unser Gespräch ein paar Tage lang analysiert hatte, musste ich mir allerdings eingestehen, dass an der Aussage meines Chefs etwas dran war. Ich spürte sofort, wenn die Stimmung kippte. Andere hatten Antennen, ich einen Fernsehturm, 368 Meter hoch und immer auf Empfang.
Hätte dein Chef zum damaligen Zeitpunkt ahnen können, wie es dir ging?
(lacht auf) Niemals. Das war die Zeit, in der ich die Meisterin im Überspielen war. Ich habe meine Unsicherheit mit guter Laune kaschiert. Mir war damals sehr wichtig, dass ich auf der Arbeit ein bestimmtes Bild abgebe: das der fröhlichen, krisenabschwächenden jungen Frau. Das war meine Stärke, und ich gab alles, um mich sozial sicher zu fühlen. Meine Strategie war, mich durchzupeitschen. Bloß keine Schwäche zeigen und immer Ausreden finden für das Zuspätkommen. Denn oft kam ich nach diesen schrecklichen morgendlichen U-Bahn-Fahrten völlig erschöpft in die Redaktion und hatte gefühlt schon einen ganzen Arbeitstag hinter mir.
Hätte es etwas genutzt, wenn dich jemand darauf angesprochen hätte?
Ich war damals noch gar nicht an dem Punkt, dass ich für Hilfe empfänglich gewesen wäre. Im Nachhinein wurde mir natürlich viel klar über die Rolle, die ich gespielt habe. Aber damals war ich überzeugt, so sei ich wirklich. Und es ist schwierig, sich anderen zu öffnen, wenn man es nicht einmal schafft, sich selbst gegenüber ehrlich zu sein. Flexiblere Strukturen hätten mir allerdings das Leben erleichtert. Ich bin damals schon viel früher zur Arbeit losgefahren, um notfalls aussteigen zu können und trotzdem pünktlich zu sein.
An guten Tagen wache ich auf und bin eine Schildkröte. Dann spaziere ich bepanzert bis an die Zähne durch die Straßen und verrichte gemächlich mein Tagewerk, Tunnelblick an und los. […] Manchmal glaube ich, dass die Mehrheit der Menschen keinen anderen Zustand kennt. […] An schlechten Tagen wache ich auf und bin ein Sieb. Geräusche, Gerüche, Farben, Stimmungen undMenschen plätschern durch mich hindurch wie Nudelwasser, ihre Stärke bleibt an mir kleben und hinterlässt einen Film, der auch unter der Dusche nicht abgeht. An diesen Tagen ist alles zu laut, zu nah, zu präsent. […] Als Sieb ist immer Tag der offenen Tür.
Damals kippte die Situation …
Ja, ich hatte zum ersten Mal eine Panikattacke während einer Redaktionskonferenz. Der Raum war voller Menschen, die Luft stickig, und ich musste als letzte meine Themen vortragen. Da bekam ich plötzlich das Gefühl, gleich ohnmächtig zu werden. Mir wurde heiß und kalt, schwindelig. Aber auch das bekam niemand mit. Ich habe einen Hustenanfall vorgetäuscht und bin geflohen.
Kommst du heute besser in den Konferenzen zurecht?
Sie behagen mir immer noch nicht. Es sind einfach zu viele Menschen in einem Raum mit geschlossener Tür – und ich weiß mittlerweile, dass ich nicht die Einzige bin, die sich so fühlt. Es braucht keine Angststörung, um sich dort unwohl zu fühlen. In diesen Konferenzen geht es außerdem vielum Macht, Selbstdarstellung und Gelaber. Sie sind zeitfressend, finden morgens statt und können bis zu anderthalb Stunden dauern. Danach bin ich wie erschlagen und könnte direkt wieder nach Hause gehen.
Ich habe mich im Nachhinein oft gefragt, warum ich erst so spät professionelle Hilfe gesucht habe. Mein Umfeld ist aufgeschlossen und tolerant, niemand hätte mich deshalb verurteilt. […] Was hatte ich also zu befürchten? Die Antwort ist: Wer eine Therapie macht, gesteht sich ein, dass er ein Problem hat. Vorher konnte ich die ganze Sache wunderbar runterspielen, vor allem vor mir selbst. Okay, ich habe da diesen Angstscheiß, Psychokram halt, aber jeder hat ja irgendwas.
Wann warst du letztendlich zur Therapie bereit?
Als es die Angst geschafft hatte, mich aus der Redaktionskonferenz zu jagen. Mir war klar, dass es ab da noch vielanstrengender werden würde als vorher, und ich wusste nicht, wie ich das täglich durchhalten sollte. Der Leidensdruck war mit einem Schlag so hoch, dass ich nur zwei Möglichkeiten sah: Therapie oder kündigen. Ich begann zunächst eine Verhaltenstherapie, die alles eher noch schlimmer machte – was allerdings vor allem am Therapeuten lag –, und landete dann glücklicherweise bei Dr. Goldberg (der Name wurde für das Buch geändert,Anm. d. Red.), der mir sowohl menschlich als auch mit einer tiefenpsychologischen Therapie wirklich helfen konnte. Bei ihm bin ich mit größeren Unterbrechungen seit ich 24 bin. Ich hatte beispielsweise ein großes Problem damit, meine persönlichen Grenzen zu ziehen und einzuhalten, das war eines der Themen, über die ich mit ihm gesprochen habe.
»Sie sind genau richtig so, wie Sie sind«, sagt Dr. Goldberg. »Aber das ist doch mal ein schöner Anlass, um über Grenzen zu sprechen. « Er schlägt die Beine übereinander und grinst. […] »Im Grenzensetzen bin ich schlecht, fürchte ich. […] Zum Beispiel dieser Text, an dem ich zuletzt gearbeitet habe. Erst fand meine Redakteurin ihn ganz toll. Und plötzlich will sie ihn um die Hälfte kürzen und alle Witze rausstreichen. Das war so nicht abgemacht. Ich bin echt sauer.«
»Kann ich verstehen. Und, wie haben Sie reagiert?«
»Am liebsten hätte ich ihr direkt eine wütende Mail geschrieben.«
»Haben Sie aber nicht.«
»Nein.«
»Und warum nicht?«
»Solange ich das Gefühl habe, eine wütende Mail schreiben zu wollen, schreibe ich keine Mail.«
»Sie warten ab, bis der Ärger verraucht ist.«
»Genau.«
»Warum?«
»Weil ich Angst davor habe, dass ich überreagiere und etwas schreibe, das ich später bereue. Und ich will auf keinen Fall, dass meine Redakteurin sauer auf mich ist.«
»Aber Sie sind doch sauer auf sie!«
»Ja, aber das weiß sie ja bisher nicht.« […]
»Wie kommen Sie eigentlich darauf«, fragt er, »dass Ihre Redakteurin sauer reagieren könnte?«
»Na, ist doch klar. Sie will etwas, ich will etwas anderes. Bestimmt denkt sie, ich sei so eine zickige Autorin mit Allüren. Ich hatte sogar schon versucht, eine Mail zu schreiben, bekam aber gleich beim ersten Satz Herzklopfen, weil ich mir vorgestellt habe, wie meine Redakteurin ihn liest. Wie sie aufgebracht ausatmet. Ich sehe das direkt vor mir.«
»Interessant. Ich wusste gar nicht, dass Sie hellsehen können.«
Ich scheitere an einem Lächeln.
Dr. Goldberg überlegt.
»Verstehe ich das richtig«, sagt er, »anstatt darüber nachzudenken, wie Sie am besten Ihr Anliegen formulieren können, stellen Sie sich direkt vor, wie das bei Ihrem Gegenüber ankommt. Sie machen quasi zwei Schritte auf einmal.«
»Vermutlich.«
»Sie wissen schon, dass Sie keinen Einfluss darauf haben, was andere fühlen, oder?«
Wie entwickelte sich die Situation damals?
Am Ende fanden wir einen Kompromiss. Das Interessante war, es trat ein, wovor ich Angst hatte: Je deutlicher ich wurde, desto unfreundlicher wurde die Redakteurin. Aber damit konnteich dann ganz gut umgehen. Mein Therapeut hatte mir gezeigt, wie man klar kommuniziert, und das fühlte sich richtig an. Was mir außerdem geholfen hatte, war, gespiegelt zu werden. Immer wenn ich dachte, dass ich sehr deutlich mache, dass mir etwas nicht passt, sagten meine Freunde, ich sei immer noch viel zu nett. Es ist so wichtig, seine Selbstwahrnehmung mit der Wahrnehmung des Umfelds abzugleichen.
Wie kam es dann dazu, dass du 2016 mit dem Artikel deinen Kampf mit der Angst publik machtest?
Ich hatte zu diesem Zeitpunkt ja schon viele Jahre Therapie und Beschäftigung mit der Angst hinter mir, war also auf einem ganz anderen Level. Irgendwann sprach ich mit einer befreundeten Kollegin aus dem Wochenendressort beim Mittagessen über das Thema und sie bestärkte mich, dass das eine gute Geschichte sei. Bis sie dann erschien, hat es noch einmal eineinhalb Jahre gedauert. Zuvor hatte ich mit meinem Therapeuten besprochen, welche Dinge ich auf jeden Fall für mich geklärt haben muss.
Wovor hast du dich am meisten gefürchtet?
Davor, bewertet zu werden. Dass die Menschen das Ausmaß nicht verstehen und sich denken: „Hat die keine anderen Probleme?“. Ich habe den Text aber letztlich erst geschrieben, als ich wusste, dass ich resistent gewesen wäre gegen das, was da kommen könnte.
Was hat dich resistent gemacht?
Es waren wirklich viele verschiedene Puzzleteile, die im Laufe der Jahre zusammenkamen: die Therapien, ein Klosteraufenthalt, Meditation, Yoga, mein überdachter Umgang mit Stress und Zeit.
Wie ging es dir, als der Artikel online ging?
Ich war so erleichtert. Und aufgeregt. Bereits nachts bekam ich eine Nachricht von einer Kollegin, die sich für den Artikel bedankte und mir sagte, sie kämpfe seit Jahren mit Depressionen. Davon hatte ich keine Ahnung. Irgendwie spielen wir alle unsere Rolle ganz gut – leider.
Gab es negative Reaktionen?
Falls ja, hat mir das jedenfalls niemand ins Gesicht gesagt. Stattdessen kamen so viele Kollegen auf mich zu, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie auch mit psychischen Problemen kämpfen würden. Seit ich darüber rede – für mich ist die Angststörung ja nichts Besonderes mehr –, entgegnet mir nahezu jeder, er habe auch Ängste oder Depressionen oder einen Burnout. Jeder hat irgendwas, man ist damit nicht alleine.
Dann gab es da noch die Warnung: „Du findest doch nie wieder einen Job!“
(lacht) Das war meine Mutter. Aber ich war mir ziemlich sicher, dass mir in meinem Bereich als Autorin keine negativen Konsequenzen drohen. Ich habe meine Angst kreativ verarbeitet, mit ihr sogar Geld verdient. Künstler dürfen so etwas aber natürlich auch eher als Ärzte, Berater oder CEOs.
Und was können Menschen in solchen Jobs tun, wenn sie Angst haben?
Mein Rat wäre: kürzer treten! Aber das machen die wenigsten aus diesen Branchen.
Bisher hatte ich immer gedacht, ich müsste mir eine dickere Haut wachsen lassen, war aber gleichzeitig ratlos, wie ich das bewerkstelligen sollte. Schließlich gab es keine Anleitung, wie man aus einem Sieb eine Schildkröte macht. […] Nein, es brachte nichts, mich mit aller Kraft verändern zu wollen. Meine Haut würde dünn bleiben. Das Einzige, was ich tun konnte, war, sie zu schützen.
Inwiefern hat die Erkenntnis, dass du hochsensibel bist, dein Verhalten beeinflusst?
Der Begriff ist leider noch nicht wissenschaftlich anerkannt, aber mir half es, mich selbst besser zu verstehen. Hochsensible haben eine feinere Wahrnehmung und sind demzufolge auch schneller überreizt. Und diese Überreizung äußert sich dann gerne in Panik. Seit ich das weiß, achte ich darauf, mir nicht zu viel zuzumuten. Zumal mein Energielevel extrem schwankt: An manchen Tagen schaffe ich total viel, an anderen gar nichts. Am Ende bewältige ich aber immer meine Aufgaben.
Die meisten Berichte von Panikpatienten sind unter Pseudonym veröffentlicht worden. Du bist ohne ausgekommen.
Bei der Recherche fand ich so vieles über Angststörungen heraus, dass es mich verunsicherte, ob ich überhaupt etwas Neues beizusteuern hatte. Da wurde mir klar, dass das Neue wäre, dazu zu stehen. Es wäre absurd gewesen, einen Text zu schreiben, in dem es darum geht, sich zu öffnen und sich dann nicht dazu zu bekennen.
Wie ist es für dich, wenn die Kollegen das Buch lesen?
Ich schreibe ja nicht über Sex, das wäre mir womöglich peinlich. Aber Gefühle sind für mich nicht intim. Mich interessieren Psychologie und die Gefühle anderer Menschen sehr – und ich gehe davon aus, dass es den anderen genauso geht.
Wurdest du von den Kollegen nach dem „Outing“ anders behandelt?
Eine Kollegin sprach aus, was wahrscheinlich viele dachten: Dass sie das niemals vermutet hätte, ich sei doch immerso fröhlich. Ich habe das Gefühl, dass jetzt eine ehrlichere Kommunikation möglich ist – ansonsten werde ich genauso behandelt wie vorher.
Kann die Panik heute noch kommen?
Ja, aber viel seltener und schwächer als früher. Ich bin gelassener, setze beängstigende Situationen in den großen Bezug und merke, wie unbedeutend sie doch oft sind. Hinzu kommt die Einsicht, dass ich selbst für meine Gefühle verantwortlich bin. Ich achte auf meine Grenzen. Es ist viel schlauer, wenn ich mir selbst die Auszeit verordne, als dass es mein Körper durch Angst oder eine depressive Episode tut.
»Ganz schön mutig von dir, das öffentlich zu machen«, sagt Sabine.
»Nicht mutig«, sage ich. Nötig. Aber vor ein paar Jahren wäre so ein Outing für mich tatsächlich noch undenkbar gewesen.«
»Was ist seither passiert?«
Ich überlege.
»Vermutlich musste ich erst selbst damit klarkommen. Jetzt sind die anderen an der Reihe.»
Franziska Seyboldt studierte Modejournalismus und Medienkommunikation in Hamburg. Die 35-Jährige ist seit 2008 Redakteurin bei der Berliner Tageszeitung Taz. Aktuell arbeitet sie auf einer halben Stelle im Wochenendressort. In der restlichen Zeit widmet sie sich dem Schreiben und gibt Lesungen. Sie debütierte mit „Das Müslimädchen. Mein Trauma vom gesunden Leben“ (2013), publizierte das Kinderbuch „Theo weiß, was er will“ und 2018 schließlich den viel beachteten autobiografischen Roman „Rattatatam, mein Herz. Vom Leben mit der Angst“.